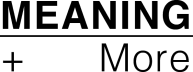Lahme Ente oder Floating Duck – Hast du das auch schon mal gefühlt?
Wie unsere Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinanderdriften – und warum wir sie öfters angleichen sollten.
Das Bild vom Eisberg kennen wir alle: oben ganz wenig los und alles ruhig, unten drunter dafür der Mega-Eisblock und eine Menge drumherum. Dass der metaphorische Blick unter die Wasseroberfläche sich auch bei Enten lohnt, ist neu.
Das liegt daran, dass wir oft dazu neigen, uns im Alltag einen abzustrampeln – so, wie eben die Ente auch unter Wasser. Und das ganz ohne, dass man es von außen wirklich mitkriegen würde. Im Gegenteil: Betroffene setzen alles dran, nach außen einen gelassenen, gar entspannten Eindruck zu vermitteln.
Es entsteht das Bild der “Floating Duck” (deutsch: schwimmende Ente), die scheinbar mühelos und anmutig über die Wasseroberfläche zu gleiten scheint. Wohl eher entsteht hier aber ein Mythos, denn in Wahrheit muss sich die Ente (wie wir eben auch) ziemlich abmühen, um sich gut über Wasser zu halten – so, wie wir auch, das ganz normale Leben eben.
Die psychologische Forschung zeigt allerdings, dass dieser Kontrast zwischen scheinbarer Leichtigkeit (im Außen) und verborgener Anstrengung (im Inneren) tiefgreifende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden haben kann.
Auf die Dauer ist diese Diskrepanz nicht nur unehrlich und erhöht soziale Spannungen, sondern belastet uns psychisch. Der Mythos von der mühelosen Perfektion verrät unsere Verletzlichkeit, die eigentliche Voraussetzung für Intimität und Verbindung.
Was diese Diskrepanz für Auswirkungen haben könnte und was Viktor Frankl wohl aus logotherapeutischer Sicht dazu gesagt hätte (Stichwort: Verantwortung und Leiden), darum geht’s in diesem Newsletter.
🔎 Aus der Forschung: Floating-Duck-Syndrom (sinngemäß: Das Syndrom der schwerelos gleitenden Ente)
Was ist das Floating-Duck-Syndrom?
Im Kern beschreibt das Floating-Duck-Syndrom die Tendenz von Menschen, ihre inneren Kämpfe und Stressoren hinter einer Fassade von äußerem Erfolg und Gelassenheit zu verbergen.
Der von der Stanford University geprägte Begriff wurde zunächst in akademischen Kreisen bekannt, bevor er als Metapher für den Druck und die Erwartungen, die in der modernen Gesellschaft herrschen, eine breitere Anwendung fand. Der wegweisende Artikel von Erol Akçay und Ryotaro Ohashi (2023) beleuchtet das Phänomen mithilfe mathematischer Modelle aus einer Perspektive sozialen Lernens.
Das Entenphänomen ähnelt dem Begriff der "mühelose Perfektion" (engl. effortless perfection), den ich im Buch Bittersweet (2022) von Susan Cain kennengelernt habe. Als er 2003 erstmalig genutzt wurde, bezog er sich „zunächst auf den Druck, der speziell auf junge Frauen ausgeübt wird: klug, schön, dünn und beliebt zu sein, ohne sich anzustrengen. Aber das Konzept wurde bald erweitert, und Studenten an anderen Schulen entwickelten ihre eigenen Begriffe“ (Cain, S. (2022). Bittersweet, S. 134, eigene Übersetzung).
So wie die anmutigen Bewegungen der Ente über die intensive Anstrengung hinwegtäuschen, die erforderlich ist, um sich vorwärts zu bewegen, bemühen sich die vom Floating-Duck-Syndrom Betroffenen, ein Bild des Erfolgs und der Vollendung zu vermitteln, während sie mit innerem Stress zu kämpfen haben.
Hinter dem ruhigen Äußeren verbergen sich Ängste, Selbstzweifel und das unerbittliche Streben nach Leistung - ein Kampf, der sich einer zufälligen Beobachtung entzieht, der aber von denjenigen, die ihn aus erster Hand erfahren, sehr stark empfunden wird.
Das Abstrampeln an sich wäre gar nicht so sehr das Thema, würden wir offen dazu stehen und (oha, wer würde das wagen?!) auch mal Hilfe annehmen. Denn wenn wir ehrlich sind, kennen wir diese Situation alle (Selbstwahrnehmung: “ich bin total am Rotieren - keine Ahnung, wie lang ich das noch durchhalten soll!).
Viel schlimmer ist hingegen die Tatsache, dass wir bei allem Stress und großer Anspannung “unter der Oberfläche” (aka in unserem Inneren) nach draußen das Bild der mühelosen Perfektion prägen wollen (Fremdwahrnehmung: “bei der läuft immer alles perfekt nach Plan, das ist alles ganz smooth”).
Ein erster Schritt hin zum besseren Umgang könnte sein, ganz ehrlich mit sich und seinem Umfeld zu sein, sich verletzlich zu zeigen. Wie geht’s mir in der aktuellen Situation, ganz ehrlich? Und wie so oft kann es helfen, die Zusammenhänge noch besser zu verstehen.
Woher kommt das Floating Duck Syndrom?
Ich wünschte, es gäbe eine bessere Antwort, aber das Phänomen ist wohl darauf zurückzuführen, wie unser modernes Leben aufgrund gesellschaftlicher Normen gestrickt ist: oftmals ein ständiges Jonglieren mit verschiedenen Verantwortlichkeiten in den Bereichen Schule, Arbeit, Familie, Freunschaften, Hobbies, und und und.
Forschungsergebnissen zufolge hat die Art und Weise, wie wir unsere Zeit und Energie auf diese Bereiche aufteilen, die Aktivitäten, die wir unternehmen, und die Belohnungen, die wir ernten, tiefgreifende Auswirkungen auf unser geistiges und körperliches Wohlbefinden.
Und dann könnte man das Bild noch weiter spannen und sagen, die individuelle Vulnerabilität, ebenso wie äußere Stressoren, ökonomische Umstände und die Art der Sozialisierung führen dazu, dass einige von uns deutlich leichter über’s Wasser des Alltags gleiten und andere sich grundsätzlich wie die lahme Ente fühlen.
Was sind die Auswirkungen?
Diese Neigung, Schwierigkeiten herunterzuspielen, unterstreicht jedoch eine umfassendere gesellschaftliche Norm, nach der Verletzlichkeit oft stigmatisiert und versteckt wird.
Diese Verinnerlichung des Kampfes macht uns nicht nur schwerer, sondern isoliert uns auch von potenziellen Quellen der Unterstützung. Oft machen wir uns vor, dass wir unsere Herausforderungen allein bewältigen müssen, ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.
Diese Tendenz zur Selbstisolierung hat jedoch ihren Preis. Indem wir uns der Möglichkeit verschließen, Unterstützung von den Menschen um uns herum zu suchen, verbarrikadieren wir uns ungewollt und behindern unsere Fähigkeit, effektiv zurechtzukommen.
Hinter der Illusion des mühelosen Erfolgs verbirgt sich eine tiefere Wahrheit: Wahre Erfüllung und echter Erfolg setzen oft voraus, dass wir die Anstrengung, die unter der Oberfläche steckt, annehmen.
Und jetzt?
Indem wir unsere Schwächen akzeptieren und diese Anstrengungen anerkennen, fördern wir eine Kultur der Transparenz und des Mitgefühls - eine Kultur, in der das Suchen nach Hilfe nicht als Zeichen der Schwäche, sondern als mutiger Schritt nach vorn angesehen wird.
🚀 Aus der logotherapeutischen Praxis: Was Viktor wohl zur Floating Duck gesagt hätte
Aus Sicht der logotherapeutischen Praxis könnte Viktor Frank womöglich auf zwei Aspekte hingewiesen haben: unsere eigene Verantwortung und die Akzeptanz von Leiden im Leben.
1. Verantwortung für die Sinnfindung in Widrigkeiten:
Der Einzelne hat immer die Freiheit und die Verantwortung hat, jeder Situation einen Sinn abzuringen, wenn auch in widrigen Umständen. Das klingt erstmal hart und anspruchsvoll und das ist es auch.
Wenn der Einzelne mit dem Druck des Floating-Duck-Syndroms konfrontiert wird, kann er sich den gesellschaftlichen Normen hingeben und im nie endenden Rennen versuchen, dern ersten Platz zu machen.
Er kann sich jedoch auch dafür entscheiden, seine Alltag bewusst zu gestalten und seine Lebensführung selbst in die Hand zu nehmen. Das würde einem aktiven Prozess von Sinnsuche enstprechen, auch und gerade angesichts von Herausforderungen.
Long story short: Indem du anfängst, bewusst deinen eigenen Werten zu folgen und deinen Alltag danach zu gestalten, kannst du immer besser ein Gefühl für Sinn in deinem Leben kultivieren, die Auswirkungen des äußeren Drucks verringern und schlussendlich mehr Zufriedenheit im Inneren erlangen.
2. Das Leiden als eine Quelle des Wachstums begreifen
Frankl betonte immer wieder, wie wichtig es ist, das Leiden als unvermeidlichen Teil der menschlichen Erfahrung anzunehmen. Shit happens, das ist nun mal so.
Im Zusammenhang mit dem "Floating-Duck-Syndrom" kann sich der Einzelne gezwungen sehen, seine Kämpfe und Anstrengungen zu verbergen, um die Fassade des Erfolgs aufrechtzuerhalten.
Indem wir aber die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, ehrlich anerkennen und akzeptieren (ja, das kann auch mal wehtun), können wir unser Leiden jedoch in eine Chance für Wachstum und Selbstentdeckung verwandeln.
Anstatt Anstrengungen und Misserfolge als Zeichen von Schwäche zu betrachten, könnten wir als Betroffene sie als wertvolle Erfahrungen erkennen, die zu unserer persönlichen Entwicklung und Widerstandsfähigkeit beitragen.
Wenn wir es dann noch wagen würden, uns verletztlich zu zeigen und gar um Hilfe zu bitten, würden wir sogar anderen Menschen Gelegenheit geben, uns etwas Gutes zu tun. Wie wäre das?
💬 On words
Vulnerability sounds like truth and feels like courage. Truth and courage aren’t always comfortable, but they’re never weakness.
– Brené Brown🧭 Zum Nachdenken und -spüren
In welcher Situation hast du dich zuletzt verletzlich gezeigt? Wie hat sich das in dem Moment angefühlt, und wie dann, nachdem eine Stunde vergangen war?
Dir wurde der Newsletter MEANING + More® weitergeleitet? Meld’ Dich jetzt kostenfrei an und werde Supporter meiner Arbeit.